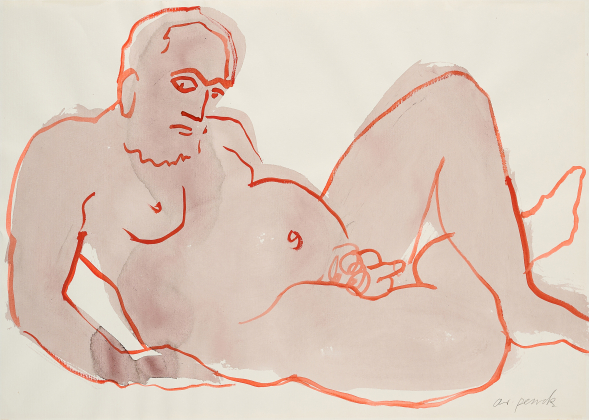Los beendet
Los 28 | A.R. Penck | Ohne Titel
Taxe
150.000
- 250.000
€
* F
Ergebnis
Unverkauft
Sie wollen ein Objekt von A.R. Penck verkaufen?
Objektbewertung
Experten
Möchten Sie A.R. Penck kaufen und zukünftig Angebote erhalten?
Objektbewertung
Experten
Möchten Sie A.R. Penck kaufen und zukünftig Angebote erhalten?
PENCK, A.R.
1939 Dresden - 2017 Zürich
Titel: Ohne Titel. 14-teilig.
Datierung: 1977.
Technik: Jeweils Dispersion auf Leinwand.
Maße: 12 Teile: 60 x 60cm. Ein Teil: 65 x 65cm. Ein Teil: 60 x 200cm.
Rahmen/Sockel: Jeweils Rahmen.
Provenienz:
- Galerie Michael Werner, Köln (Aufkleber)
- Galerie Rudolf Zwirner, Köln
- Unternehmenssammlung Deutschland (1981 von Vorheriger erworben)
Ausstellungen:
- Kunsthaus Zürich, 1988
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2019
Literatur:
- Ausst.-Kat. A.R. Penck, Kunsthaus Zürich, Berlin 1988, S. 192/93; 249, Kat.-Nr. 83, Abb.
- Ausst.-Kat. A.R. Penck "Ich aber komme aus Dresden (check it out man, check it out)", Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 2019, S. 217, Abb.
- Kunsthistorisch äußerst wertvolle Provenienz
- Zugleich schwelgerische Schöpfungsgeschichte und systematische Grundlagenforschung
- Auf 14 Tafeln entfaltet sich die spezifische Zeichensprache von A. R. Penck
Schematisierung des Sichtbaren
A.R. Penck, dessen Pseudonym auf den deutschen Geologen und Eiszeitforscher Albrecht Penck verweist, wird 1939 als Ralf Winkler in Dresden geboren. Antiideologisch und kompromisslos, strebt Penck schon früh nach künstlerischer Unabhängigkeit und bildet sich autodidaktisch weiter, nachdem ihm ein offizielles Akademiestudium verwehrt wird. Seine analytische Haltung treibt ihn zeitlebens zu einer Art Bildforschung, für die er die Erkenntnisse der Philosophie, Mathematik, Logik, Musik und Lyrik hinzuzieht. Entsprechend entfaltet sich seine künstlerische Tätigkeit auf vielfältigen Gebieten: Neben Gemälden, plastischen und grafischen Werken, verfasst er Gedichte und Texte und veröffentlicht eigene Jazzalben, für die er die Cover gestaltet.
A.R. Penck, der bereits seit 1962 in der DDR nicht mehr öffentlich ausstellen darf, vertritt sein künstlerisches Anliegen trotz zunehmender Repressalien durch das Ministerium für Staatssicherheit standhaft und unterhält bis zu seiner Ausbürgerung 1980 enge Verbindungen zur westdeutschen Kunstszene. Vor allem trägt sein Freund und Galerist Michael Werner zur erfolgreichen und weitreichenden internationalen Verbreitung seines Werks bei, die sich in Teilnahmen an der Biennale in Venedig (1984) und documenta (1972, 1982 und 1992) niederschlägt.
In Korrespondenz zu seiner unangepassten Rolle in der DDR, befreit sich Penck künstlerisch von der Abhängigkeit des Sichtbaren, um sich stattdessen mit einer Methode der starken Vereinfachung "ein Bild zu machen" (Wolfgang Opitz im Gespräch mit Asteris Kutulas in: "Als wir uns bewußt als Untergrund bezeichneten", "Die Union", 6./7.10.1990). Pencks Gemälde beruhen auf der systematischen Erfassung von komplexen Prozessen der sichtbaren Welt in schaubildartigen Bildarrangements. Tatsächlich bezeugen frühe Tagebucheinträge aus den 1960er Jahren seine Hinwendung zu schematischen Aufzeichnungen über Physik, insbesondere mechanische Vorgänge. Auf der Suche nach einer universellen Bildsprache orientiert sich Penck an den grafischen Darstellungen von Informationstheorien und kybernetischen Studien.
Das StandART System
Ausgehend von technischen Zeichnungen von Kreisläufen und Kraftfeldern entwickelt Penck mit einfachen geometrischen Formen und Vektoren jene zum Inbegriff seiner Kunst gewordenen Zeichen und Figuren, die an primitive Bildformen und frühe Schriftzeichen, etwa an Höhlenmalereien und Graffiti erinnern. Mit diesem zunehmend formelhaft reduzierten, "standardisierten" Vokabular seines "StandART"-Systems erkundet Penck auch das Verhältnis zwischen Figur und Raum.
Den Gegenstand bewältigt er zeichnerisch mittels einer starken Kontur oder Linie zur unmittelbaren Vergegenwärtigung. In der diagrammatischen Abstraktion auf das Äußerste reduziert, bevölkern Strichfiguren, Pfeile und Kreuze als kraftvolle Komponenten die Gemälde von Penck in einem genau austarierten Beziehungsgefüge. Bei seiner Beobachtung von Landschaftsszenarien wie Ateliersituationen konzentriert sich Penck stets auf Trennungen und Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen, etwa Stein, Wasser, Erde, Luft, Mensch, Tier und Pflanze.
Die Penck´sche Kosmogonie
Im Werk "Ohne Titel" von 1977 erstreckt sich über 14 Bildeinheiten gleichsam die Penck´sche Kosmogonie. Das Werk erweist sich zugleich als schwelgerische Schöpfungsgeschichte und systematische Grundlagenforschung, als eine Versuchsreihe "über Zeichen und Zeichenräume und den Signalcharakter von Zeichen und Symbolen." (A.R. Penck zit. nach Pressetext Retrospektive Frankfurt, Schirn Kunsthalle 2007) Sowohl in ihrer flüchtig skizzenhaften als auch fundamental formgebenden Qualität treten jene konstruktiven und stilbildenden Bausteine, die Pencks Bildwelten zugrunde liegen, in mannigfaltigen Kombinationen hervor.
Diese einzelnen Motive werden zu dynamischen Momenten in der "phänomenologischen Überschau" (Wolfgang Opitz im Gespräch mit Asteris Kutulas in: "Als wir uns bewußt als Untergrund bezeichneten", in: "Die Union", 6./7.10.1990) von Pencks Strichfiguren-, System- und Weltbildern. Darin lotet er nicht nur malerisch das Verhältnis von Figur und Grund im bewegten Bildgeschehen aus. Vielmehr ist seinen Werken eine soziale und politische Dimension eingeschrieben, die in seinen biografischen Erfahrungen begründet liegt und den Menschen in Verbindung zur Gesellschaft und Umwelt - als universelles Beziehungsgefüge - reflektiert. Er beleuchtet die Rolle des (Künstler-)Individuums im Kontext des Kollektivs, in dem die Wirksamkeit - und der Widerstand - des Einzelnen gegen die Macht der Allgemeinheit immer wieder aufs Neue erkämpft werden muss.
Bettina Haiss
1939 Dresden - 2017 Zürich
Titel: Ohne Titel. 14-teilig.
Datierung: 1977.
Technik: Jeweils Dispersion auf Leinwand.
Maße: 12 Teile: 60 x 60cm. Ein Teil: 65 x 65cm. Ein Teil: 60 x 200cm.
Rahmen/Sockel: Jeweils Rahmen.
Provenienz:
- Galerie Michael Werner, Köln (Aufkleber)
- Galerie Rudolf Zwirner, Köln
- Unternehmenssammlung Deutschland (1981 von Vorheriger erworben)
Ausstellungen:
- Kunsthaus Zürich, 1988
- Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2019
Literatur:
- Ausst.-Kat. A.R. Penck, Kunsthaus Zürich, Berlin 1988, S. 192/93; 249, Kat.-Nr. 83, Abb.
- Ausst.-Kat. A.R. Penck "Ich aber komme aus Dresden (check it out man, check it out)", Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden 2019, S. 217, Abb.
- Kunsthistorisch äußerst wertvolle Provenienz
- Zugleich schwelgerische Schöpfungsgeschichte und systematische Grundlagenforschung
- Auf 14 Tafeln entfaltet sich die spezifische Zeichensprache von A. R. Penck
Schematisierung des Sichtbaren
A.R. Penck, dessen Pseudonym auf den deutschen Geologen und Eiszeitforscher Albrecht Penck verweist, wird 1939 als Ralf Winkler in Dresden geboren. Antiideologisch und kompromisslos, strebt Penck schon früh nach künstlerischer Unabhängigkeit und bildet sich autodidaktisch weiter, nachdem ihm ein offizielles Akademiestudium verwehrt wird. Seine analytische Haltung treibt ihn zeitlebens zu einer Art Bildforschung, für die er die Erkenntnisse der Philosophie, Mathematik, Logik, Musik und Lyrik hinzuzieht. Entsprechend entfaltet sich seine künstlerische Tätigkeit auf vielfältigen Gebieten: Neben Gemälden, plastischen und grafischen Werken, verfasst er Gedichte und Texte und veröffentlicht eigene Jazzalben, für die er die Cover gestaltet.
A.R. Penck, der bereits seit 1962 in der DDR nicht mehr öffentlich ausstellen darf, vertritt sein künstlerisches Anliegen trotz zunehmender Repressalien durch das Ministerium für Staatssicherheit standhaft und unterhält bis zu seiner Ausbürgerung 1980 enge Verbindungen zur westdeutschen Kunstszene. Vor allem trägt sein Freund und Galerist Michael Werner zur erfolgreichen und weitreichenden internationalen Verbreitung seines Werks bei, die sich in Teilnahmen an der Biennale in Venedig (1984) und documenta (1972, 1982 und 1992) niederschlägt.
In Korrespondenz zu seiner unangepassten Rolle in der DDR, befreit sich Penck künstlerisch von der Abhängigkeit des Sichtbaren, um sich stattdessen mit einer Methode der starken Vereinfachung "ein Bild zu machen" (Wolfgang Opitz im Gespräch mit Asteris Kutulas in: "Als wir uns bewußt als Untergrund bezeichneten", "Die Union", 6./7.10.1990). Pencks Gemälde beruhen auf der systematischen Erfassung von komplexen Prozessen der sichtbaren Welt in schaubildartigen Bildarrangements. Tatsächlich bezeugen frühe Tagebucheinträge aus den 1960er Jahren seine Hinwendung zu schematischen Aufzeichnungen über Physik, insbesondere mechanische Vorgänge. Auf der Suche nach einer universellen Bildsprache orientiert sich Penck an den grafischen Darstellungen von Informationstheorien und kybernetischen Studien.
Das StandART System
Ausgehend von technischen Zeichnungen von Kreisläufen und Kraftfeldern entwickelt Penck mit einfachen geometrischen Formen und Vektoren jene zum Inbegriff seiner Kunst gewordenen Zeichen und Figuren, die an primitive Bildformen und frühe Schriftzeichen, etwa an Höhlenmalereien und Graffiti erinnern. Mit diesem zunehmend formelhaft reduzierten, "standardisierten" Vokabular seines "StandART"-Systems erkundet Penck auch das Verhältnis zwischen Figur und Raum.
Den Gegenstand bewältigt er zeichnerisch mittels einer starken Kontur oder Linie zur unmittelbaren Vergegenwärtigung. In der diagrammatischen Abstraktion auf das Äußerste reduziert, bevölkern Strichfiguren, Pfeile und Kreuze als kraftvolle Komponenten die Gemälde von Penck in einem genau austarierten Beziehungsgefüge. Bei seiner Beobachtung von Landschaftsszenarien wie Ateliersituationen konzentriert sich Penck stets auf Trennungen und Verbindungen zwischen den einzelnen Elementen, etwa Stein, Wasser, Erde, Luft, Mensch, Tier und Pflanze.
Die Penck´sche Kosmogonie
Im Werk "Ohne Titel" von 1977 erstreckt sich über 14 Bildeinheiten gleichsam die Penck´sche Kosmogonie. Das Werk erweist sich zugleich als schwelgerische Schöpfungsgeschichte und systematische Grundlagenforschung, als eine Versuchsreihe "über Zeichen und Zeichenräume und den Signalcharakter von Zeichen und Symbolen." (A.R. Penck zit. nach Pressetext Retrospektive Frankfurt, Schirn Kunsthalle 2007) Sowohl in ihrer flüchtig skizzenhaften als auch fundamental formgebenden Qualität treten jene konstruktiven und stilbildenden Bausteine, die Pencks Bildwelten zugrunde liegen, in mannigfaltigen Kombinationen hervor.
Diese einzelnen Motive werden zu dynamischen Momenten in der "phänomenologischen Überschau" (Wolfgang Opitz im Gespräch mit Asteris Kutulas in: "Als wir uns bewußt als Untergrund bezeichneten", in: "Die Union", 6./7.10.1990) von Pencks Strichfiguren-, System- und Weltbildern. Darin lotet er nicht nur malerisch das Verhältnis von Figur und Grund im bewegten Bildgeschehen aus. Vielmehr ist seinen Werken eine soziale und politische Dimension eingeschrieben, die in seinen biografischen Erfahrungen begründet liegt und den Menschen in Verbindung zur Gesellschaft und Umwelt - als universelles Beziehungsgefüge - reflektiert. Er beleuchtet die Rolle des (Künstler-)Individuums im Kontext des Kollektivs, in dem die Wirksamkeit - und der Widerstand - des Einzelnen gegen die Macht der Allgemeinheit immer wieder aufs Neue erkämpft werden muss.
Bettina Haiss
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin:
Los ausdrucken | Los empfehlen |
Hinweise zum Los
Regelbesteuerung, MwSt. ist ausgewiesen
27,00 % Aufgeld auf den Zuschlagspreis
7% MwSt. auf die Summe von Zuschlag und Aufgeld
Folgerechtabgabe
zzgl. Folgerechtabgabe von 1,5% auf den Hammerpreis bis zu 200.000 €
Verwandte Werke in der Auktion
A.R. Penck Deutschland Neoexpressionismus Figurative Malerei Neue Wilde Nachkriegskunst Unikate 1970er Jeweils Rahmen Figur / Figuren Gemälde Dispersion
A.R. Penck Deutschland Neoexpressionismus Figurative Malerei Neue Wilde Nachkriegskunst Unikate 1970er Jeweils Rahmen Figur / Figuren Gemälde Dispersion
Inventar Nummer: 79360-53
Weitere Lose, die Sie interessieren könnten
- Taxe: 100.000 - 150.000 €
03.12.2025 - ca.18:36Modern | Post War | Contemporary | Galerie Thomas | The Jagdfeld Collection | Auktion 03.12.2025 - Taxe: 18.000 - 24.000 €
04.12.2025 - ca.17:15Modern | Post War | Contemporary | Galerie Thomas | The Jagdfeld Collection | Auktion 03.12.2025 - Taxe: 15.000 - 20.000 €
04.12.2025 - ca.17:15Modern | Post War | Contemporary | Galerie Thomas | The Jagdfeld Collection | Auktion 03.12.2025 - Taxe: 7.000 - 10.000 €
04.12.2025 - ca.17:16Modern | Post War | Contemporary | Galerie Thomas | The Jagdfeld Collection | Auktion 03.12.2025 - Taxe: 15.000 - 20.000 €
04.12.2025 - ca.17:17Modern | Post War | Contemporary | Galerie Thomas | The Jagdfeld Collection | Auktion 03.12.2025